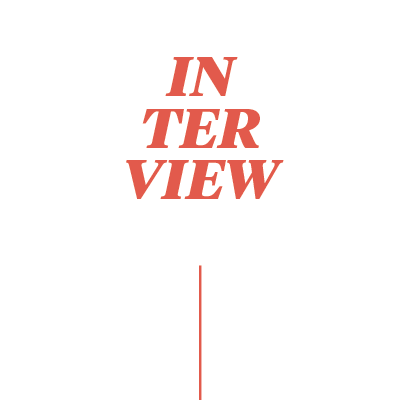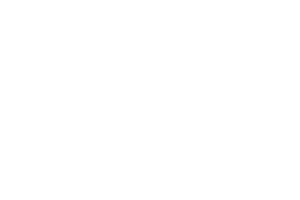Das hat sich aber doch in den folgenden Jahren sehr verändert.
B. Heller: Nicht sofort, aber wir haben relativ schnell begonnen, in Richtung Serienmaschinen zu entwickeln. Mit der Baureihe PF, einer damals neuartigen Fahrständermaschine, ist uns das dann teilweise gelungen. Mit der Entwicklung der BEA 1 konnten wir dann eine erste echte Serienmaschine auf den Markt bringen. Von diesem Typ konnten pro Jahr mehr als 100 Maschinen verkauft werden. Trotzdem war die Transferstraße immer noch der Umsatzträger Nummer eins.
H. Heller: Die Entwicklung der BEA 1 hat sich mit den Kundenforderungen nach mehr Flexibilität überschnitten. Wir haben damals in einem ersten Schritt versucht, über standardisierte Schnittstellen mehr Flexibilität in die Transferstraßen zu bringen und sind dann im Weiteren dazu übergegangen, flexible Linien aus verketteten Bearbeitungszentren anzubieten.
Könnte man die Entwicklung der Bearbeitungszentren auch mit dem Bemühen erklären, sich etwas aus der Abhängigkeit zur Automobilindustrie zu lösen?
H. Heller: Natürlich. Aber das wird oft missverstanden. Wir haben zu unseren Kunden rund um die Automobilindustrie ein gutes Verhältnis und es ging uns nicht darum, sich von der „übermächtigen“ Automobilindustrie zu lösen, sondern darum, von den Investitionszyklen dieser Branche unabhängiger zu werden und sich kundenmäßig breiter aufzustellen.
Ist das in etwa auch die Zeit, in der bei HELLER die eigene CNC-Steuerung uniPro entwickelt wurde?
B. Heller: Wir hatten nicht nur die CNC, wir hatten auch eigene speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und die Antriebe. Die uniPro war leistungsmäßig mit an der Spitze der damals verfügbaren Steuerungen. Gleichzeitig konnten wir die Regelalgorithmen an unsere Maschinenkonzeption anpassen und so ein perfektes Miteinander von Maschine und Steuerung sicherstellen.
Trotzdem hat man die Weiterentwicklung der uniPro eingestellt.
B. Heller: Was nur logisch war. Unsere Kunden wollten sich zum einen auf möglichst wenige Steuerungslieferanten konzentrieren und gleichzeitig machte es die Internationalisierung unserer Geschäfte unumgänglich, auf eine Steuerung zuzugreifen, die überall auf der Welt bekannt war.
Es gab also keine technischen Gründe, die eigene Steuerungsentwicklung einzustellen?
B. Heller: Ganz und gar nicht. Ich würde auch heute noch sagen, dass die uniPro leistungsmäßig mit an der Spitze der damals verfügbaren CNC-Steuerungen stand. Das zeigte sich auch daran, dass Siemens einige unserer Features und Softwareentwicklungen nur zu gerne in seine eigene CNC integriert hat.
Sie haben die Internationalisierung angesprochen. Auch das eine Entwicklung, die ihre Kunden forciert haben?
H. Heller: So ist es. Beispiel Brasilien: Viele deutsche Automobilhersteller hatten dort eigene Produktionswerke gegründet und die Ausrüster angehalten, es ihnen gleichzutun. Hinzu kamen Einfuhrzölle auf Werkzeugmaschinen von weit über 30 Prozent. Vor allem aber war der Service für uns ausschlaggebend, vor Ort zu sein. Anderes Beispiel England: Auch hier war es die damals noch starke Automobilindustrie, die uns in einem ersten Schritt veranlasst hat, erst eine schlagkräftige Serviceniederlassung aufzubauen und dann im weiteren Verlauf dort auch zu produzieren.
Nun gilt, dass der Werkzeugmaschinenbau gut ausgebildete Fachkräfte benötigt. Das dürfte in Brasilien nicht ganz einfach gewesen sein. Woher kamen die Fachkräfte?
H. Heller: Anfänglich haben wir vor allem deutschstämmige Mitarbeiter gesucht, schon um die Sprachbarrieren so gering wie möglich zu halten. Diese haben wir hier in Nürtingen intensiv ausgebildet, bevor sie zurück nach Brasilien sind und dort als Multiplikatoren weitere Mitarbeiter geschult haben. Heute steht uns dort eine hochmotivierte Mannschaft zur Verfügung, die hervorragende Arbeit leistet.
B. Heller: Wobei man nicht unterschlagen sollte, dass sich dort in den Anfangsjahren eine interessante Konstellation ergeben hat, mit drei Vertriebs- und Montagefirmen – neben HELLER gehörten noch Index und Pfauter zu dem Verbund –, die sich eine gemeinsame mechanische Fertigung geteilt haben. Keiner von uns hätte sich allein eine derart gut ausgestattete Fertigung leisten können. Leider hat sich diese im weiteren Fortgang aufgelöst, wobei wir die mechanische Fertigung als Nukleus unseres Werks in Brasilien genutzt und ausgebaut haben. In Spitzenzeiten kamen von dort immerhin bis zu 120 Maschinen pro Jahr.
Eine Zahl, von der man heute um einiges entfernt sein dürfte …
B. Heller: … nicht unbedingt. Momentan dürfte der Ausstoß bei rund 100 Zentren liegen.